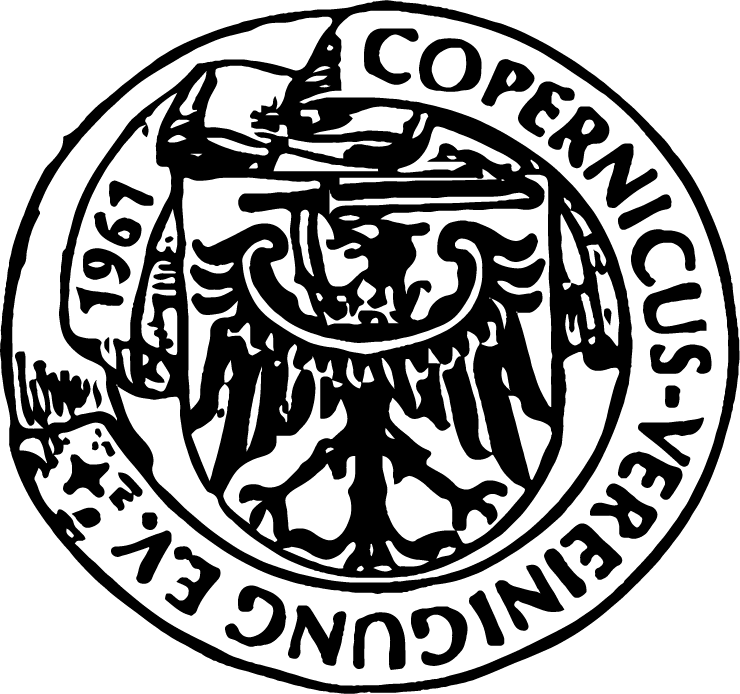
Copernicus-Vereinigung e.V
Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens
Die Übersetzung wird automatisch generiert.
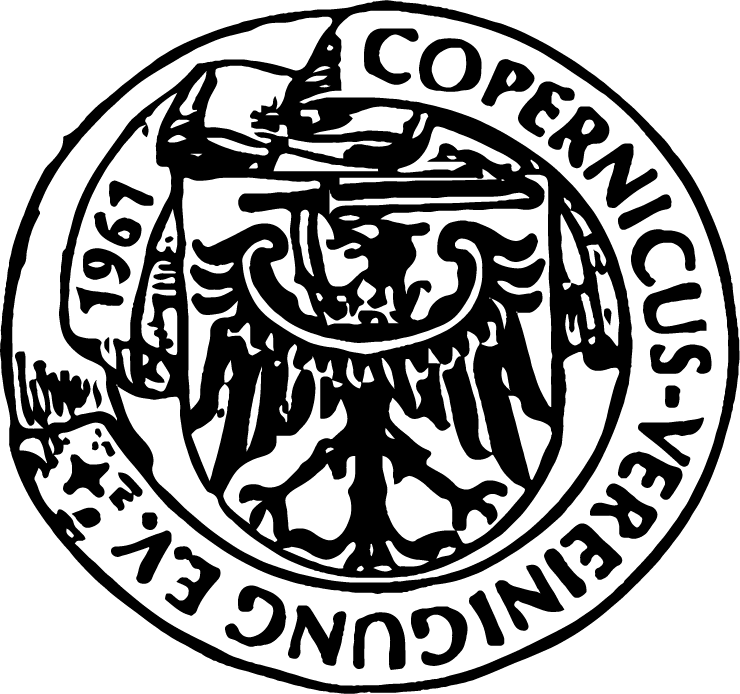
Copernicus-Vereinigung e.V
Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens
Die Übersetzung wird automatisch generiert.
Die Geschichte und Landeskunde Westpreußens zu erforschen, Forschungen zur und in der Region zu fördern, die kulturelle Vielfalt Westpreußens im Laufe der Jahrhunderte in die Öffentlichkeit zu tragen und deren Erbe zu erhalten und pflegen.
1961 in Münster gegründet, widmet sich die Copernicus-Vereinigung der Erforschung von Landeskunde und Geschichte Westpreußens. Dabei knüpft sie an die Traditionen des Copernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn (gegr. 1854), an den Historischen Verein für die Stadt und den Regierungsbezirk Danzig (gegr. 1879), den späteren Westpreußischen Geschichtsverein und an die des Historischen Verein für den Regierungsbezirk Marienwerder (gegr. 1876) an. Die Zerteilung der Provinz Westpreußen nach dem Ersten Weltkrieg und Flucht und Vertreibung aufgrund des Zweiten Weltkrieges haben die Vereinsarbeit erschwert und teilweise zum Erliegen gebracht. Nach der Neugründung wurde von Anfang an das Ziel verfolgt – in Verbindung mit der historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und den weiteren historischen Verein der Region, die Forschungen und Veröffentlichungen von Arbeiten über westpreußische Themen anzuregen und zu fördern.
Die Forschung und Veröffentlichung von Arbeiten über westpreußische Themen anzuregen und zu fördern. Alle interessierten sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Erfahren Sie auf den weiteren Seiten mehr über die Aktivitäten, Publikationen und Forschungsprojekte der Copernicus-Vereinigung. Steigen Sie ein in die faszinierende Welt der historischen und landeskundlichen Forschungen zu Westpreußen.

Als preußisches Landesteil manifestiert sich die Region Westpreußen in der Inkorporation von 1454 in den polnisch-litauischen Gesamtstaat unter der Bezeichnung königliches Preußen oder preußische Lande königlichen Anteils. Seine Sonderstellung zog dieses Territorium durch das verbriefte Indignat, welches öffentliche Ämter den Einwohnern Preußens vorbehielt. Im Zweiten Thorner Frieden von 1466 erhält Danzig zudem erhebliche Sonderrechte. Bis 1569 bestimmt der preußische Landtag mit Vertretern von Geistlichkeit, Adel und Städten, die Geschicke des Landes. Aus dem ursprünglichem Amt des Statthalters geht der Landesrat hervor, unter dem Vorsitz des ermländischen Bischofs, mit den Wojewoden und Kastelanen, auch die der Städte Danzig, Elbing und Thorn. Bis zur Reformation bleiben die Diözesangrenzen des Deutschen Ordens erhalten. Nach Untergang des Rigaer Erzbistums wird das Bistum Kulm Gnesen unterstellt, Ermland wird exemt. Preußen königlichen Anteils ist in der Mitte des 16. Jahrhunderts weitgehend protestantisch, die von Stanislaus Hosius, u.a. durch die Ansiedlung des ersten Jesuitenkollegs in Braunsberg betriebene Gegenreformation zeitigt Erfolge für die katholische Reformbewegung. Das Fürstbistum Ermland bleibt katholisch, weitere Strecken Westpreußens werden rekatholisiert. Die großen Städte bleiben hingegen protestantisch – mit wetteifernden lutherischen und reformierten Prägungen. Durch die Lubliner Union von 1569 wird Westpreußen Teil des neuen polnischen Gesamtstaates. Aus der Personalunion wird eine Realunion, Westpreußen verliert seine Sonderrechte. Danzig leistet allein Widerstand, wird 1577 unterworfen und behält dennoch weitgehende Autonomie und Sonderrechte in der polnischen Adelsrepublik. Die religiöse Toleranz führt zu Ansiedlungen von Mennoniten in der Weichselniederung, von Glaubensflüchtlingen aus Schottland, den Niederlanden und Böhmen in Westpreußen. Während die Gebiete im Südwesten des Landesteils um Konitz und Schlochau und die Städte Danzig, Thorn und Elbing deutschsprachig geprägt bleiben, werden die restlichen Teile Westpreußens zunehmen polnischsprachig dominiert. Die polnisch-schwedischen Kriege (1626-1635 und 1655-1660) belasten Westpreußen stark. Es wird zum Hauptkriegsschauplatz, Dörfer werden verwüstet, Städte besetzt und geplündert. Wirtschaftlicher Niedergang ist die Folge, der durch den Nordischen Krieg (1700-1721) – auch durch die Besetzung Danzigs durch Schweden und Russen – noch verstärkt wird. Dennoch bleibt Danzig die unangefochtene Handelsmetropole der Region. Religiöse Spannungen entladen sich zudem nicht selten gewalttätig, mit ihrem traurigem Höhepunkt im sogenannten Thorner Blutsonntag von 1724. Medial aufgeladen wird er zum Fanal für das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten, zu einer fatalen Gleichsetzung der polnischen Nation mit der katholischen Religion und der deutschen mit der protestantischen Religion.
Mit diesem Formular können Sie ganz bequem und einfach Mitglied im Verein werden.
Aufnahmeantrag
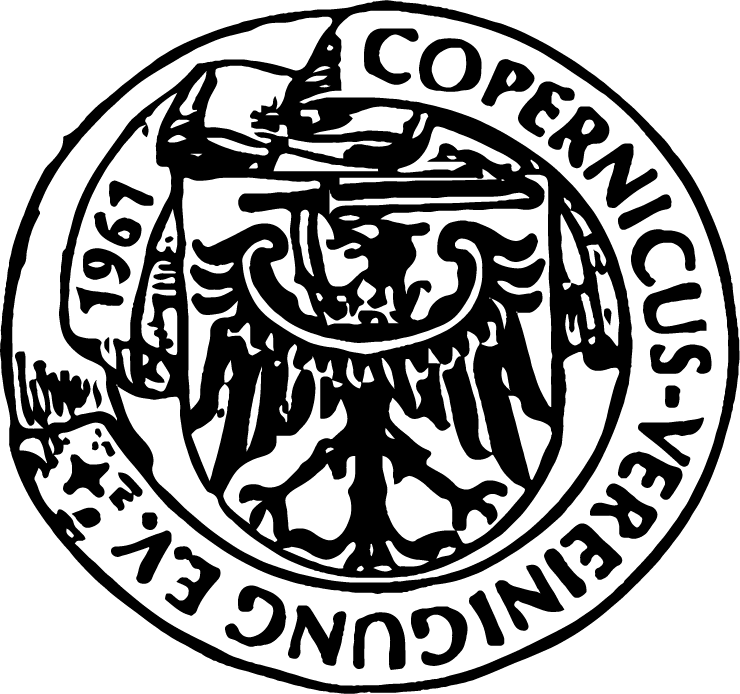
Diese Webseite verwendet Cookies, die notwendig sind, um die Webseite zu benutzen. Sie ermöglichen zum Beispiel die Seitennavigation. Ohne diese Cookies kann unsere Webseite nicht richtig funktionieren. Weitere Informationen findest du in unsere Datenschutzerklärung.